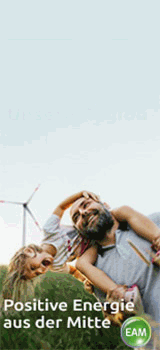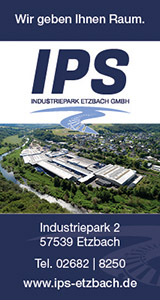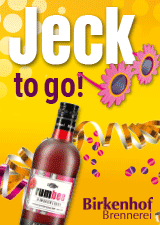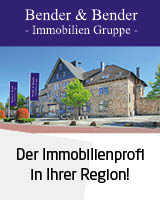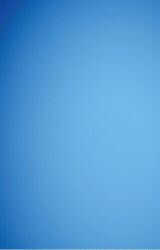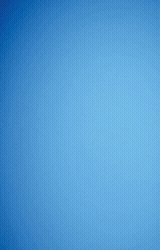GGL veröffentlicht Details: Was steht im Tätigkeitsbericht für 2024?
RATGEBER 18+ | Hinweis: Dieser Artikel ist für ein erwachsenes Publikum bestimmt und behandelt Themen (beinhaltet ggf. Links), die sich an Personen ab 18 Jahren richten. Manche Berichte landen direkt nach dem Erscheinen im Archiv. Der Tätigkeitsbericht 2024 der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder ist das genaue Gegenteil. Auf rund 130 Seiten entfaltet sich ein Rückblick mit Weitwinkel, dicht an der Praxis, reich an Zahlen und mit einem klaren Blick auf das, was noch kommt. Die GGL hat sich im vergangenen Jahr nicht nur als Kontrollinstanz behauptet, sondern als aktiver Gestalter eines Marktes, der sich ständig neu justieren muss. Unter der nüchternen Oberfläche des Berichts steckt eine deutliche Botschaft, so funktioniert die Aufsicht nicht nebenbei, sie ist das Rückgrat eines Systems, das sich dem Spiel mit dem Risiko verpflichtet hat.

Ein Jahr intensiver Regulierung – GGL und der legale Glücksspielmarkt
Regulierung hat oft den Ruf, trocken und bürokratisch zu sein. Doch 2024 war kein Jahr der Routine. Insgesamt 230 Anträge wurden bearbeitet, manche davon mit Änderungswünschen, andere komplett neu. Erfasst wurden dabei sämtliche Angebote aus dem digitalen Glücksspielbereich, also von virtuellen Automatenspielen über Online-Poker bis hin zu Sportwetten.
141 Anbieter standen unter Aufsicht. Diese Zahl zeigt, wie viel Bewegung und Vielfalt innerhalb des legalen Markts mittlerweile existiert. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen unregulierten Markt, wo Spieler keine Spielpausen einlegen müssen und sich die Slots ständig weiterdrehen.
Zusätzlich sorgten internationale Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele für erheblichen Mehraufwand, denn mit der erhöhten medialen Aufmerksamkeit steigt auch die Aktivität in den Wettmärkten und damit das Risiko von Regelverstößen.
Die GGL begegnet diesen Entwicklungen nicht mit mehr Personal allein, sondern vor allem mit technologischen Mitteln. Dynamische Überwachung, gezielte Risikoanalysen und technische Werkzeuge sichern eine Aufsicht, die nicht nur formal, sondern auch faktisch funktioniert.
Regulierung schützt Leben – die Rolle der Spielerschutzmaßnahmen
Regeln durchzusetzen ist die eine Seite. Die andere besteht darin, Verantwortung zu übernehmen für Menschen, deren Spielverhalten außer Kontrolle zu geraten droht. Die sogenannten „Markers of Harm“ sind keine abstrakten Konzepte mehr. Es handelt sich um Verhaltensmuster, die frühzeitig auf problematisches Spielverhalten hinweisen, zum Beispiel dann, wenn jemand regelmäßig hohe Summen einzahlt oder zu ungewöhnlichen Zeiten besonders aktiv ist.
Solche Marker kommen insbesondere bei Spielern zum Einsatz, deren monatliche Einzahlungen sich in einem Bereich zwischen 1.000 und 10.000 Euro bewegen. Im vergangenen Jahr bestätigte das Verwaltungsgericht Mainz die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen. Eine Entscheidung, die der GGL Rückenwind verschafft, da sie zeigt, dass präventiver Spielerschutz nicht im luftleeren Raum operiert, sondern auf festen rechtlichen Füßen steht.
Illegales Glücksspiel bleibt hartnäckig – mit welchen Mitteln die GGL dagegenhält
Die Zahlen des Berichts liefern ein klares Bild. Rund 1.700 Webseiten wurden 2024 überprüft, 231 Untersagungsverfahren folgten. Darunter waren zahlreiche Anbieter, deren Geschäft bewusst außerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen angesiedelt war. Die Antwort der GGL fällt entschieden aus, so wurde Geo-Blocking auf 657 Domains angewendet, während hunderte Verfahren zum Zahlungsstopp eingeleitet wurden, um den Geldfluss zu unterbinden.
Dabei kamen erstmals in größerem Umfang rechtliche Spielräume zum Tragen, die der europäische Digital Services Act ermöglicht. Besonders relevant war zudem eine neue Regelung bei Google, denn seit September 2024 dürfen nur noch Anbieter mit offizieller deutscher Lizenz dort Werbung für Glücksspiele schalten. Dieser Schritt wird im Bericht als besonders wirkungsvoll bezeichnet, da er die Sichtbarkeit illegaler Angebote erheblich reduziert hat.
Trotzdem wird keine Euphorie verbreitet. Die GGL spricht von einer „anspruchsvollen Lage“, was in diesem Kontext bedeutet, dass sich der illegale Markt anpasst und kreative Wege sucht, um weiterhin präsent zu sein. Wer glaubt, mit ein paar Sperren sei das Problem gelöst, liegt falsch. Es braucht Ausdauer, Technik und die Bereitschaft, regulatorisch nachzulegen.
Zahlen, die den Markt erklären
Wer wissen will, wie viel Geld im Glücksspiel steckt, sollte genau hinschauen. Der Bruttospielertrag des gesamten legalen Marktes betrug 2024 rund 14,4 Milliarden Euro. Davon wurden etwa 7 Milliarden Euro über Steuern und Abgaben an staatliche Stellen und soziale Sicherungssysteme abgeführt.
Innerhalb dieses Rahmens steuerte der Online-Sektor 4 Milliarden Euro bei und das entspricht rund 28 Prozent des Gesamtvolumens. Eine weitere Zahl fällt auf, der Gesamteinsatz bei Sportwetten belief sich erstmals auf vollständig erfasste 8,2 Milliarden Euro. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, der sich wohl auch durch sportliche Großereignisse erklären lässt.
Kanalisierung auf dem Prüfstand
Ein zentrales Ziel des Glücksspielstaatsvertrags besteht darin, Spieler vom illegalen Markt in den regulierten Bereich zu lenken. Diese sogenannte Kanalisierung liegt derzeit bei 50 bis 54 Prozent und das ist ein Wert, der deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Der Bericht benennt die Ursachen offen. Illegale Anbieter locken mit großzügigen Boni, verzichten auf Einschränkungen wie Sperrdateien und bieten oft eine Benutzeroberfläche, die einfacher zu bedienen ist als die ihrer legalen Konkurrenten. Zudem fehlen vielen Spielern Informationen darüber, welche Angebote überhaupt lizenziert sind.
Die GGL sieht hierin eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Es reicht nicht aus, illegale Angebote zu blockieren. Der legale Markt muss so überzeugend auftreten, dass es keinen Grund mehr gibt, auf Alternativen auszuweichen. Das bedeutet bessere Nutzererfahrung, mehr Transparenz und konsequente Aufklärung.
Erfolg oder Dauerbaustelle – was bleibt zu tun und was kommt als Nächstes?
Der Bericht macht keinen Hehl daraus, dass die Aufsicht über das Glücksspiel in Deutschland ein Projekt mit offenem Ende ist. Zwar zeigen viele Maßnahmen Wirkung, doch die Baustellen sind weiterhin groß. Neue Klageverfahren, stärkere Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und der Ausbau technischer Kontrollinstrumente stehen ganz oben auf der Agenda.
Geplant ist unter anderem die Einführung sogenannter Safe-Server, die Anbieterstrukturen transparenter machen sollen. Auch das Werbemonitoring wird erweitert, insbesondere mit Blick auf digitale Kanäle, die bislang schwer zu erfassen waren. Ziel ist eine Aufsicht, die nicht erst eingreift, wenn Verstöße bereits öffentlich sichtbar sind, aber möglichst frühzeitig erkennt, wo Regeln umgangen werden.
2026 und 2028 im Blick – die Evaluation des Glücksspielstaatsvertrages
Der Blick nach vorn ist im Bericht allgegenwärtig. Im Jahr 2026 steht die erste umfassende Evaluation des Glücksspielstaatsvertrags durch die Politik an. Dabei geht es um die Frage, ob das gesamte Regelwerk trägt. Die aktuelle Kanalisierungsquote dürfte dabei eine zentrale Rolle spielen, ebenso wie die Effektivität der Kontrollinstrumente.
Zwei Jahre später, also 2028, müssen die Bundesländer darüber entscheiden, ob sie den Vertrag verlängern oder neu aufsetzen. Noch ist offen, ob alle Länder weiter an einem Strang ziehen oder ob sich einzelne für einen eigenständigen Weg entscheiden. (prm)
Hinweis zu den Risiken von Glücksspielen und Geldanlagen:
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsbewusst und nutzen Sie bei Bedarf Hilfsangebote wie die Suchtberatung (Link: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - Glücksspielsucht).
Ebenso birgt jede Geldanlage Risiken. Investieren Sie nur so viel, wie Sie bereit sind zu verlieren, und informieren Sie sich gründlich über die Anlageprodukte, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Dieser Artikel stellt keinerlei finanzielle Beratung dar. Informieren Sie sich bitte eigenständig über Experten, bevor Sie eine Investition tätigen.