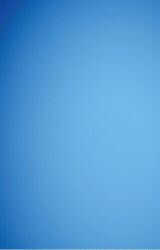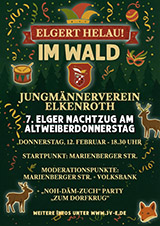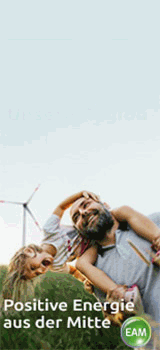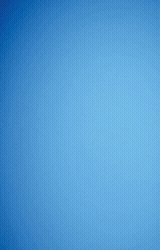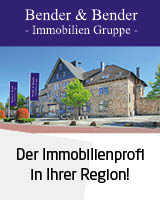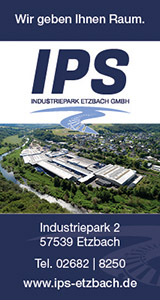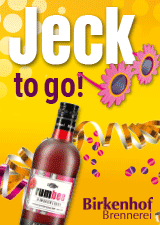Resolution der VG Altenkirchen-Flammersfeld fordert „differenziertes Wolfsmanagement“
Die Rückkehr des Wolfes in heimische Gefilde erregt weiterhin die Gemüter – derzeit jedoch nicht unbedingt in der breiten Öffentlichkeit. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verabschiedete eine Resolution mit einer Empfängeradresse in Mainz, in der er "ein differenziertes Wolfsmanagement“ fordert.

Altenkirchen. Nach wie vor ist die Rückkehr des Wolfes in den Westerwald ein Thema, das in vielen Kreisen sehr unterschiedlich und auch emotional diskutiert wird. Die Gründung eines Arbeitskreises „Wolf“ war das Resultat eines Treffens von Ortsbürgermeistern aus dem „erweiterten“ Mehrbachtal mit der Spitze der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld, Vertretern der im VG-Rat vertretenen Fraktionen sowie der Verwaltung. Aufgabe des Arbeitskreises soll es sein, innerhalb der unterschiedlichen Gruppierungen (Landwirtschaft, Kleintierhaltung, Jagd, Landesforsten Rheinland-Pfalz, Kommunalpolitik und Verwaltung) untereinander sowie gemeinsam und kooperativ mit den zuständigen staatlichen Stellen einen konstruktiven Austausch mit Blickrichtung Wolfsvorkommen in der VG zu erreichen. In der ersten Sitzung des Arbeitskreises wurde zudem über die Ausarbeitung einer Resolution beschlossen, die der VG-Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 1. Oktober, final verabschieden soll. Der Entwurf fand schon im Treffen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses am späten Dienstagnachmittag (23. September) ungeteilte Zustimmung bei einer Enthaltung. Die Erklärung soll schließlich an das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland Pfalz unter Ministerin Katrin Eder (Bündnisgrüne) geschickt werden. „Wir haben unseren Weidetierhaltern gezeigt, wir ducken uns nicht weg. Wir zeigen den Menschen, dass wir sie verstanden haben“, sagte Bürgermeister Fred Jüngerich und sprach von einem „ersten Aufschlag“ mit Blickrichtung eines guten Miteinanders zwischen dem Ministerium und der auf VG-Ebene neu gegründeten Arbeitsgruppe, in der Weidetierhalter als auch Naturschützer vertreten sind. Stephanie Bärhausen (AfD) stufte den Wortlaut des Schreibens als nicht „forsch genug für unsere Weidetierhalter ein“. Ein Wolf im Westerwald wurde nach Jahrzehnten der Abstinenz zum ersten Mal am 13. Mai 2018 per Foto auf dem Stegskopf (bei Emmerzhausen) nachgewiesen. Seit Februar 2021 ist der männliche graue Wolf 1896 (GW1896m) des Leuscheider Rudels der Schrecken aller Weidetiere in seinem Revier, das vor allen Dingen die Kreise Altenkirchen, Neuwied und Rhein-Sieg umfasst – wie nachweislich zuletzt am 14. Juli bei einem Nutztierriss bei Hennef. Der Wortlaut der Resolution:
Die Ausgangslage
Der Wolf ist zweifellos ein bedeutender Bestandteil europäischer Artenvielfalt, und sein Schutz stellt einen Erfolg des Artenschutzes und der Biodiversität dar. Auch wenn der Erhaltungszustand in der gesamten kontinentalen Region noch als nicht ausreichend bewertet werden kann, so erachten die kommunalen Gremien in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld den Erhaltungszustand durch das Leuscheider, das Hachenburger und das Puderbacher Rudel im Westerwald für gewährleistet. In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, einer Region, in der Landwirtschaft, Weidetierhaltung, Jagd und Tourismus eng miteinander verflochten sind, führt die Ausbreitung des Wolfs zunehmend zu starken Interessenkonflikten in den vorgenannten Bereichen und mitunter zu Ängsten in der Bevölkerung. Seit dem Jahr 2020 gab es in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (Stand 30. August 2025) 59 Übergriffe auf Nutztiere, bei denen 119 Tiere verletzt bzw. in den meisten Fällen getötet wurden. Der seit März 2021 als Leitwolf des Leuscheider Rudels etablierte Rüde GW1896m konnte seitdem bundeslandübergreifend in seinem derzeitigen Territorium an 107 Rissen mit mehr als 207 toten Nutztieren nachgewiesen werden. Diese Schadensbilanz ist bundesweit einmalig. Von Wölfen gerissene Weidetiere, beziehungsweise eher die daraus resultierenden emotionalen Belastungen der Weidetierhalter, zeigen, dass der gesellschaftliche Konsens zur Koexistenz von Menschen, Weidetieren und Wolf regional an seine Grenzen gestoßen ist. Aber gerade dieser gesellschaftliche Konsens ist wichtig, um die mit der Koexistenz verknüpfte Akzeptanz in der Bevölkerung zu festigen. Eine Reduzierung von Übergriffen wird nicht ohne einen flächendeckenden und einen der guten fachlichen Praxis entsprechenden Herdenschutz bei Schafen, Ziegen, Gehegewild und Jungtieren möglich sein. Dies ist aber aufgrund der Topografie des Westerwaldes, geprägt von offenen Bachtälern, Heckenstrukturen und kleinen Feldgehölzen, schwierig und sehr pflegeintensiv.
Regionale Herausforderungen
In der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld haben die Weidetierhaltung und die Jagd eine lange Tradition und sind ökologisch, soziologisch sowie kulturell unverzichtbar. Schäfer, Landwirte, Tierhalter und Jäger sehen sich jedoch zunehmend überfordert. Herdenschutzmaßnahmen werden zwar finanziell durch das Land gefördert, der damit in Verbindung stehende Veränderungsprozess im Weidemanagement wird aber bezüglich der Praktikabilität und des Zeitaufwandes kaum berücksichtigt. Eine wirtschaftliche, ökologische und dem Tierwohl entsprechende Nutztierhaltung wird aufgrund zunehmender Tierseuchen, Resistenzen von Endoparasiten sowie bürokratischer Hürden immer herausfordernder. Auch wenn der Wolf hinsichtlich dieser steigenden Herausforderungen häufig fälschlicher weise als ursächlich genannt wird, führt die Angst vor weiteren Rissen zu einem schleichenden Vertrauensverlust in die zuständigen staatlichen Stellen. In der ländlich geprägten Region des Westerwaldes, in der mittlerweile die Wolfspräsenz mit drei Rudeln in unmittelbarer Umgebung deutlich spürbar ist, müssen bundeslandübergreifende und für die Weidetierhalter spürbare Lösungen ermöglicht werden. Die Jagd im Westerwald wird vornehmlich von passionierten privaten Jägern und Jägerinnen ausgeübt. Der Druck auf diese Personen, die ihre Leidenschaft einzig durch hohe private Investitionen finanzieren, ist in den letzten fünf Jahren sehr stark angestiegen. Klimaveränderungen und Käferkalamitäten haben riesige Fichtenwälder vernichtet. Mehrere tausend Hektar müssen zu klimastabilen und artenreichen Mischwäldern erzogen werden. Dazu muss der Wildverbiss an Forstpflanzen durch Rehwild reduziert werden. Zusätzlich führen steigende Schwarzwildpopulationen, im Schatten eines drohenden Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest, zu erhöhten landwirtschaftlichen Schäden. Die Lösungsansätze für diese Probleme stehen allesamt mit einer zu reduzierenden Wilddichte in Verbindung. Der Wolf als Superprädator wird alleine dieses Ziel nicht herbeiführen können. Zusätzlich nimmt er Einfluss auf das bisher bekannte Verhalten von Rehen und Wildschweinen. Es ist daher unbedingt erforderlich, die Attraktivität und Durchführbarkeit der Jagd in der Region zu erhalten und zu fördern.
Vorschläge
Die kommunalen Gremien schlagen ein differenziertes Wolfsmanagement vor, das der besonderen regionalen Lage gerecht wird. Die beabsichtigte Aufnahme des Wolfs ins Landesjagdrecht Rheinland-Pfalz mit einem ganzjährigen Schutzstatus ist ein symbolischer Akt, der für sich genommen vermutlich keine Veränderung bewirken wird. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Jagdpächter künftig die Verantwortung für die Hege und Pflege des Wolfes haben, jedoch ohne rechtssichere Handlungsmöglichkeiten. Dies würde voraussichtlich den Druck auf die Jagdausübungsberechtigten verstärken und damit die Attraktivität der Jagd eher schmälern. Stattdessen bedarf es wissenschaftlicher Untersuchungen zur Verhaltensveränderung von Schalwild durch den Wolf, durch das Freizeitverhalten der Menschen und durch Habitat-Veränderungen sowie einer Förderung einer die Jagdbezirke übergreifenden Zusammenarbeit. Ein regional differenziertes Bestandsmanagement, das eine ständige und intensive Zusammenarbeit der für das Leuscheider Rudel verantwortlichen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in einer Arbeitsgruppe erfordert, ist von Nöten. Das Wolfsmonitoring muss relevantere Ergebnisse für das Wolfsmanagement liefern. Es braucht dringend verifizierte Antworten auf drängende Fragen zum Herdenschutz und zur Bestandsregulierung. Da bei sind auch Verhaltensänderungen von Herdentieren, insbesondere von Großvieh, zu betrachten. Das Wolfsmanagement muss zudem schnelle und effiziente Möglichkeiten des Abschusses von auffälligen Wölfen durch vom Land beauftragte Jäger entwickeln. Dabei dürfen verfahrens- und mitteloffene Lösungen kein Tabu darstellen. Der Herdenschutz muss weiterhin in mindestens gleicher Höhe gefördert werden. Zusätzlich ist eine Schulung und Beratung betroffener Tierhalter im eigenen Betrieb zu forcieren, um weiterhin eine tierwohlgerechte Haltung zu gewährleisten. Die mit Entscheidung des Verwaltungsgericht Koblenz vom 17. Dezember 2024 aufgehobene Ausnahmegenehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord sollte neu betrachtet werden. Es wäre zielführend, die in der Urteilsbegründung des Gerichts aufgeführten Aspekte und notwendigen Ergänzungen in einer neuen Ausnahmegenehmigung (bei erneuter Auffälligkeit) aufzunehmen.
Schlusswort
Die Bedeutung des Artenschutzes ist unbestritten. Die kommunalpolitischen Gremien stehen jedoch auch in der Verantwortung der in den Dörfern lebenden und arbeitenden Bevölkerung. Es braucht einen homogenen Ausgleich der Interessen zwischen Landbevölkerung, Naturschutz, Landwirtschaft und Jägerschaft. Die Landesregierung sollte jetzt ihre spürbare Handlungsfähigkeit zeigen. (vh)
Lokales: Altenkirchen & Umgebung
Feedback: Hinweise an die Redaktion