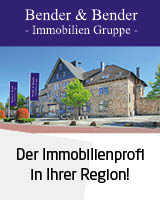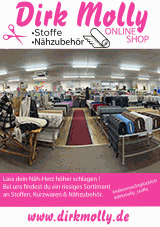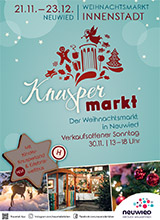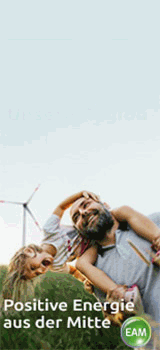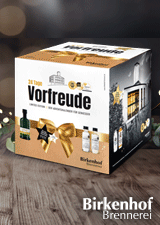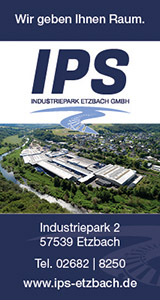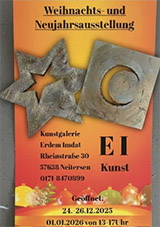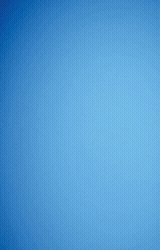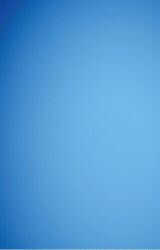Wie hat die Priorisierung des Tierschutzes die Gesetzgebung beeinflusst?
ARTIKEL 18+ | Hinweis: Dieser Artikel ist für ein erwachsenes Publikum bestimmt und behandelt Themen (beinhaltet ggf. Links), die sich an Personen ab 18 Jahren richten. Schottland, Wales und Neuseeland haben alle vor Kurzem angekündigt, dass Windhundrennen effektiv verboten werden. Explizit werden die Rennbahnen, auf denen diese Wettkämpfe stattfanden, verboten. Im DACH-Raum sind kommerzielle Hunderennen schon seit längerer Zeit verboten. Sie dürfen maximal in privaten Vereinen ohne Wettangebot und ohne kommerzielle Anreize ausgetragen werden.

Diese Entscheidung, welche in Schottland vor allem symbolischen Charakter hat, da es dort gar keine aktiven kommerziellen Bahnen gibt, spiegelt einen weltweiten Trend wider1: Dem Tierwohl wird ein immer höherer Stellenwert beigemessen. Mancherorts muss dafür auch Tradition weichen. In Deutschland fordern rund 80 Prozent der Bundesbürger, dass die Tierschutzgesetze verschärft werden2.
Diese Forderung lässt sich auf eine gestiegene Wahrnehmung von Tierleid innerhalb der Gesellschaft, vor allem in Verbindung mit Schlachtbetrieben und der Folgen von Fleischproduktion für die Umwelt zurückführen. Seit Jahren steigt die Zahl der Veganer sowie Vegetarier im DACH-Raum. Ein Grund, weshalb der Fleischkonsum abnimmt. Dieser Wandel im Denken und Handeln schlägt sich an immer mehr Stellen in der Gesetzgebung nieder.
Geschichte des Tierschutzes in Deutschland
Das erste Mal kam in Deutschland Tierschutz im Jahr 1871 vage zur Sprache. Damals wurde ein Gesetz in das Reichsgesetzbuch des deutschen Kaiserreiches aufgenommen, das es verbietet, Tiere in der Öffentlichkeit oder „in Ärgernis erregender Weise” zu quälen.3 Auf ein eigenständiges Tiergesetz musste man dann mehr als 60 Jahre warten – bis 1933.
Im neuen Gesetz wurde dann unter anderem die „grausame Tierquälerei” verboten und festgelegt, dass „warmblütige Nutztiere” von der Schlachtung zu betäuben sind. Danach passiert für knapp 40 Jahre wenig in Bezug auf Tierschutzgesetze. Im Jahr 1971 wird dann ein neues Gesetz zum Schutz von Tieren verabschiedet. Ab dann werden die Rechte und Pflichten von Tierhaltern geregelt. Dieses Gesetz wurde bis heute mehrmals angepasst – um weitere Praktiken wie das Verbot des Kürzens von Schwänzen bei Hunden und des Entkrallens von Katzen.
Den nächsten großen Schritt im heimischen Tierschutz gibt es im Jahr 2002, als das Tierwohl in das Grundgesetz aufgenommen und damit zum Staatsziel erklärt wird. Das Gesetz wurde bis heute immer weiter angepasst, unter anderem, um neue EU-Vorgaben umzusetzen, wie das Verbot des Tötens von Küken und die Qualzucht.
Blick über die Grenze: Tierschutz in der Schweiz und in Österreich
In anderen Teilen des DACH-Raums gibt es im Bereich Tierschutz deutlich strengere Regeln. Gerade die Schweiz ist ein Vorreiter im internationalen Vergleich. Die Alpenrepublik ist neben Uhren auch für ihren Käse bekannt – und hat die Würde des Tieres in ihrer Verfassung festgeschrieben. Dieser Schritt spiegelt sich in der Gesetzgebung wider. Unter anderem ist gesetzlich festgelegt, dass soziale Tiere einen angemessenen Kontakt zueinander haben sollen.
Auch Österreich ist seit Jahren auf den vorderen Plätzen, wenn es um den Anteil an Veganern beziehungsweise Vegetariern in der Bevölkerung geht. Das Land von Wiener Schnitzel und Sissi wandelt sich. Es hat sich in Sachen Tierschutz als EU-Musterschüler erwiesen. Pelzfarmen gehören hier der Vergangenheit an und Legebatterien werden auch bald verboten – deutlich vor dem von der EU vereinbarten Aus.
Gesellschaftlicher Wandel
In den letzten Jahren hat sich die Gesellschaft massiv gewandelt. Unter anderem ist der Fleischkonsum fast überall in der EU gesunken. Diese Entwicklung ging auch an der Politik nicht spurlos vorbei.
Der Blick auf den Konsum von tierischen Produkten wandelt sich. In Deutschland ist der Fleischkonsum pro Jahr von 60 Kilo im Jahr 2020 auf 52 Kilo im Jahr 2024 gesunken, während die Umsätze von pflanzlichen Alternativen Rekordumsätze feiern4. Die Zahl der Veganer, Vegetarier und Flexitarier steigt weiter. Das feuert auch die Nachfrage nach Alternativen an und eröffnet neue Märkte.
Gleichzeitig beeinflussen auch unzählige Skandale in der Massentierhaltung, die von Tierquälerei über Ausbeutung bis hin zu gesundheitlich schädlichen Verunreinigungen reichen, den Blick auf das Thema Tierschutz. Fast jährlich gibt es neue Skandale. Tierschutzorganisationen machen gezielt darauf aufmerksam und fordern bitter nötige politische Veränderungen. Diese Vorstöße verlaufen jedoch leider oft im Sand. Dennoch wird an Beispielen wie diesen deutlich, dass oft aus Mitgefühl ein gewisser politischer Wille entsteht. Tierschutz ist mittlerweile ein zentraler Teil der Wertepolitik des deutschsprachigen Raums und aus dieser nicht mehr wegzudenken.
EU und Tierwohl im europäischen Vergleich
Wie funktioniert Tierschutz auf europäischer Ebene? Dort wurde im Jahr 1998 mit der Richtline 98/58/EG festgelegt, welche Standards mindestens für die Tierhaltung von den Mitgliedsstaaten eingehalten werden müssen. Außerdem hat die Europäische Union Tiere als fühlendes Wesen eingestuft und verpflichtet alle Mitgliedstaaten dazu, dem Wohl von Tieren „in vollem Umfang Rechnung zu tragen“.
Im europäischen Vergleich steht Deutschland im Mittelfeld mit seinen Tierschutzbemühungen. Andere Staaten wie die Niederlande oder Schweden hingegen sind klare Vorreiter – noch vor Österreich. In diesen beiden Ländern gibt es deutlich strengere Vorgaben für die Schweinehaltung sowie für den Transport von Tieren. Auch Transparenz wird dort großgeschrieben. Seit Kurzem wird das auch auf EU-Ebene diskutiert – mit der Idee, im Jahr 2026 eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung einzuführen. Diesem Vorschlag widersetzt sich Deutschland noch. Dieses Problem gibt es auch bei weiteren Vorstößen – einige Mitgliedstaaten verlangen Veränderung, während andere Fortschritte blockieren.
Wirtschaftliche und ethische Auswirkungen
Nicht immer steht die Politik auf der Seite der Produzenten. Die EU hat eine neue Verordnung zum schrittweisen Umbau von Schweineställen auf den Weg gebracht. Diese sieht unter anderem vor, dass Schweine mehr Platz bekommen. Die Kosten für diesen Umbau werden in Deutschland bundesweit auf knapp 15 Milliarden Euro geschätzt. Sie stellen zahlreiche Betriebe, laut eigener Aussage, vor finanzielle Herausforderungen. Diese Bauern sorgen sich darum, ihre eigene Wirtschaftlichkeit zu erhalten5.
Die Gesellschaft muss sich zwei fundamentale Fragen stellen. Erstens: Was ist uns Tierwohl finanziell wert? Um zu überleben, müssen die Landwirte ihre Preise erhöhen. Konsumenten müssen akzeptieren, diese zu zahlen. Die zweite Frage knüpft daran an. Sollten Importe aus Ländern mit günstigerer Fleischproduktion gestattet sein? Wenn unsere heimische Industrie mit ihren Standards nicht wettbewerbsfähig sein kann, sollten Importe aus Ländern ohne diese Standards untersagt oder mit hohen Zöllen belegt werden. So könnte sich die Umstellung auch hierzulande für die Landwirte lohnen.
Auch in der ethischen Debatte hat sich einiges getan. Die Frage, ob man Tiere als einen reinen Produktionsfaktor oder doch eher als Geschöpfe mit Bedürfnissen sehen sollte, wird immer öfter gestellt. Sie lässt sich nicht mehr von der Politik ignorieren und fließt immer öfter und stärker in die Entscheidungsprozesse mit ein. Durch diesen Druck haben sich einige idealistische Forderungen und Argumente durchgesetzt, denen sich die Landwirtschaft in Zukunft unterwerfen muss. Doch die Politik könnte die Umstellung erleichtern, beispielsweise mit gezielten Förderprogrammen.
Zukunftsaussichten: Tierschutz im Jahr 2030
Auch wenn vor allem Veganismus gerne als Trend verschrien wird, wird deutlich, dass das Thema Tierschutz als zentrale Frage in der Mitte Gesellschaft bleiben wird. Im Jahr 2025 gab es zum Beispiel einen Antrag im Bundestag, der forderte, das Tierschutzgesetz zu reformieren. In dieser Forderung spiegeln sich Pläne der Ampel-Regierung wider, unter anderem, eine verpflichtende Haltungskennzeichnung. Diese soll es Kunden ermöglichen, schnell und einfach zu erkennen, woher genau das Fleisch kommt und wie das entsprechende Tier gehalten wurde. So ließe sich mehr Transparenz in der Liefer- und Wertschöpfungskette schaffen. Hierbei könnte auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Beispielsweise könnte man die Technologie dazu einsetzen, um die Ställe und die Gesundheit der Tiere zu überwachen.
Bei der Debatte sollten auch Klimaschutzaspekte nicht unerwähnt bleiben. Tierhaltung ist einer der größten Klimasünder weltweit – schlimmer als der gesamte Verkehr der Welt. Damit Klimaziele erreicht werden können, muss die Zahl an Nutztieren verringert und weniger Fleisch konsumiert werden. Hier hat Deutschland und Europa die Möglichkeit, sich als Vorbild für andere Länder zu etablieren.
Abschließende Gedanken zum Tierschutz
In diesem Artikel bin ich tief in Geschichte des deutschen Tierschutzes eingetaucht. Die Tendenz geht in Richtung eines besseren Schutzes von Tieren. Doch die Reise ist noch nicht vorbei. Vor allem, wenn es um die ökologischen Aspekte von Tierhaltung geht, lässt sich erkennen, dass es noch viel zu tun gibt.
Dennoch wird deutlich, dass sich die Gesellschaft – in vielen Bereichen positiv – verändert. Ziele, die früher utopisch wirkten, gelten heutzutage als erreichbar. Heute kann man tierische Produkte konsumieren, die auf eine ökologische und ethische Weise hergestellt wurden. Um dem Ziel von mehr Tierwohl noch näher zu kommen, sollte man akzeptieren, dass Tierprodukte teurer werden. Dabei muss die Politik sicherstellen, dass die Rahmenbedingungen die Landwirte bei der Umstellung unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit – und damit die Lebensgrundlage der heimischen Industrie – geschützt bleibt. Die Erfüllung all dieser Bedingungen kommt nachhaltig dem Tierwohl zugute. (prm)
(1) Tierschutz vor Tradition: Schottland zieht Schlussstrich unter Windhundrennen Geschrieben von Thoma Kellner und veröffentlicht von CasinoTopsOnline.com/de
(2) Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich mehr Tierwohl – die Politik muss endlich entsprechend handeln geschrieben und veröffentlicht von Vier Pfoten
(3) Tierschutzrecht geschrieben und veröffentlicht von Wikipedia
(4) Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch sinkt auf unter 52 Kilogramm geschrieben und veröffentlicht von BLE
(5) Schweinezucht in Niedersachsen: Warum Bauern in der Krise stecken Geschrieben und veröffentlicht von NDR
Hinweis zu den Risiken von Glücksspielen:
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsbewusst und nutzen Sie bei Bedarf Hilfsangebote wie die Suchtberatung (Link: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - Glücksspielsucht).